Der Lischka Prozess
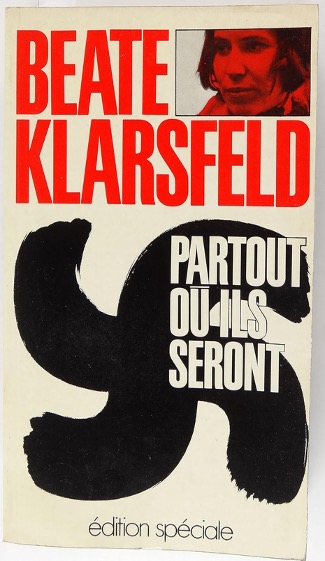
Anne Klein, Jens Tanzmann, Jonas Pottgießer
___________________________________________________
April 1974- Verhaftung in Dachau S. 300-308-Auszüge
Wir arbeiten einen Plan aus. Jede unserer Aktionen muss Personen oder Orte einbeziehen, die eine starke symbolische Bedeutung haben, damit sich diejenigen, gegen die sich die Aktionen und Demonstrationen richten, ihre Verantwortung vor Augen führt. Morgen wird das Symbol Dachau und meine Verhaftung dort sein. Wir müssen der deutschen Polizei eine Falle stellen, denn wenn ich außerhalb des Geländes verhaftet werde, geht der gewünschte Effekt verloren. Wir müssen davon ausgehen, dass bei keinem Polizisten das Betreten eines Geländes, auf dem Zehntausende von Antinazis ermordet wurden, zu einer Konfrontation mit seinem Gewissen führen wird. Das ist eines der Probleme des deutschen Gewissens: das Fehlen von Reflexion und Verständnis, sowohl auf individueller als auch auf institutioneller Ebene. Es gibt viel zu wenige Menschen, die sich der Gerechtigkeit und der Hilfe für das jüdische Volk verpflichtet fühlen und Verantwortung für die Vergangenheit übernehmen.
Ich werde mich also verhaften lassen. Ich weiß nicht, für wie lange. Meine Freilassung wird von der Reaktion auf meine Verhaftung abhängen. Dieses Mal verlasse ich mich auf die Unterstützung aus Israel, wo ich so herzlich empfangen wurde. Aber ich weiß, dass es in dieser grausamen Welt nicht leicht ist, moralische Empörung zu wecken. Die deutsche Justiz reagiert mit Strenge gegenüber denjenigen, die die etablierte Ordnung angreifen.
(…)
Ich verlasse Paris am Dienstagabend, den 16. April, mit zwei treuen Gefährten, Henri Pudeleau und Henri Wolff. Sie fahren mit mir als Zeichen der Solidarität der Deportierten und um die Verbindung zwischen dem Kampf von gestern und dem von heute zu zeigen.
Vor der Gedenkstätte Dachau kommen zwei Polizeiautos und ein mit Polizisten besetzter Bus an. Trotz des exterritorialen Status des ehemaligen Lagers betreten drei Polizisten in Zivil das Gelände und nähern sich unserer Gruppe – mir, meinen beiden Freunden in ihren KZ-Mänteln und ein paar Journalisten. Sie teilen mir mit, dass ich verhaftet bin, und führen mich mit jener unheimlichen, legalen Art und Weise ab, die den Opfern der Nazis, wenn auch unbewusst, Angst einjagt. Ich werde in das bayerische Staatsgefängnis gebracht. Früh am nächsten Morgen bringen mich vier Polizisten in einem Auto von München nach Köln, in das Gefängnis Ossendorf, in dem ich bereits 1971 eingesperrt worden war.
Am nächsten Tag findet in Tel Aviv eine Demonstration vor der deutschen Botschaft statt. Die Teilnehmenden skandieren: „Nazis rein, Beate raus!“ Serge steht in täglichem Kontakt mit Tel Aviv; ein Büro und ein Telefon haben uns die Eltern unseres Freundes Francis Lenchener großzügig zur Verfügung gestellt. Akiva Nof, Yoella Harshafi, Simha Holzberg, Bronia Klibansky, Myriam Meyouhas und Haika Grossman tun in Tel Aviv ihr Bestes, um die öffentliche Meinung aufzurütteln. Benjamin Halevi, Mitglied der Knesset und ehemaliges Mitglied des Obersten Gerichtshofs Israels, geht am 20. April persönlich in die deutsche Botschaft und bittet um meine Freilassung.
Am 23. April kommt es zu einer Demonstration vor der deutschen Botschaft auf den Champs-Elysées. Die französische Presse kritisiert die „Taktlosigkeit“ der bayerischen Polizei. Aber die deutsche Presse berichtet praktisch nichts über diese Ereignisse in Israel und auch nicht über die in Frankreich. Wir müssen den Druck erhöhen, sonst werde ich bis zu meinem Prozess, der für Juni angesetzt ist, im Gefängnis bleiben.
……………………..
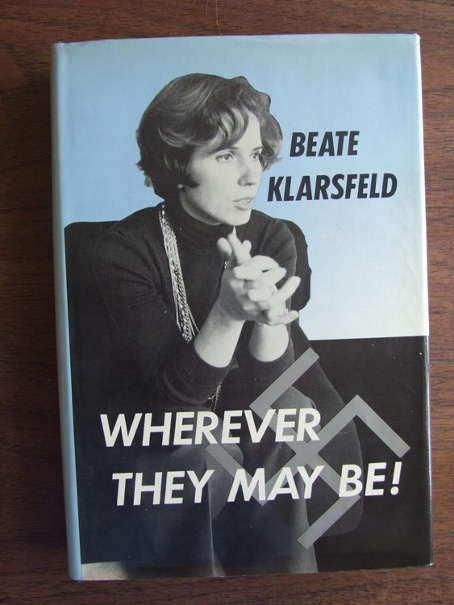
Mai 1974 Demonstration in Bonn
Mehrere Delegationen ehemaliger Maquisards und Deportierter – ca. 45 Personen – demonstrieren am 2. Mai unter der Leitung von Julien Aubart vor dem Bundestag in Bonn Die Widerstandskämpfer tragen alle ihre Orden, die ehemaligen Deportierten ihre KZ-Kleinung. Serge hat eine Reihe von Plakaten und Transparenten vorbereitet. Die Delegation begibt sich zum Pressehaus in der Nähe des Bundestags und dringt in die Sicherheitszone ein. Journalisten strömen zum Ort des Geschehens. Ebenso wie die Polizei – mehr als zweihundert Uniformierte, behelmt und mit Schlagstöcken bewaffnet. Nach mehreren erfolglosen Warnungen bereitet sich die Polizei auf den Angriff vor. Den deutschen Reportern gelingt es, sie davon abzubringen. Sie warnen vor dem verheerenden Eindruck, den Fotos machen würden, die zeigen, wie die deutsche Polizei die Helden der französischen Résistance attackiert.
Am frühen Nachmittag kommt die französische Delegation – gefolgt von drei Bussen mit Polizisten – zum Gefängnis in Köln Ossendorf. Jeder hat einen dreifarbigen Strauß dabei. Bald werden vor den Augen der Presse, der Gefängniswärter und der immer zahlreicher werdenden Bürger fünfundvierzig dreifarbige Sträuße vor dem Eingang des Gefängnisses niedergelegt und Transparente hochgehalten. Julien Aubart, die beiden Henris (Pudeleau und Golub) und meine Schwiegermutter besuchen mich im Gefängnis. Das Gefängnispersonal zeigt sich beeindruckt von dieser, für einen Gefangenen beispiellosen Demonstration. Ich tue meinerseits, was ich kann, um das Personal davon zu überzeugen, dass meine Haltung der Sache, für die ich eintrete, würdig ist.
————————————————————————————————-
Kurz vor dem Prozess in Köln, S. 308- 310
„In Köln kämpfen Arie Marinsky und Anwalt Stange Zentimeter für Zentimeter mit Victor de Somoskoey, dem Vorsitzenden des Gerichts, einem strengen, unnachgiebigen Mann, der den Prozess auf einen Gesetzesverstoß beschränken will. In seinen Augen bin ich lediglich ein Delinquent in einer Zivilsache. Er versteht die öffentliche Aufregung über meine Verhaftung nicht und will sie auch nicht verstehen. Am Ende der achtstündigen Diskussion erwirkt Marinsky meine Freilassung. Benjamin Halevi bürgt dafür, dass ich zu meinem Prozess erscheinen werde. Er erstattet zudem dem Journalisten Heiner Lichtenstein die vor drei Jahren von ihm gezahlte Kaution von 30.000 Mark zurück. De Somoskoey scheint den Eindruck gewonnen zu haben, dass nur Stange für meine Verteidigung zuständig sein wird, so dass er keiner Konfrontation mit dem israelischen Anwalt Marinsky erwart. Aber schon bald wird er erkennen, dass dies ein Irrtum ist.
_____________________________________
Prozess gegen Beate Klarsfeld, S. 311-S. 321
25. Juni 1974 – Beginn des Prozesses
Am ersten Tag des Prozesses druckt Le Monde einen Artikel mit Hintergrundinformationen zum Zusatzabkommen zum Überleitungsvertrag und zur Rolle von Lischka bei den Deportationen aus Vichy- Frankreich. Nach diesem Artikel sind wir gut gerüstet; die Franzosen verstehen, warum wir kämpfen. Der Verwaltungsangestellte von Premierminister Chirac empfängt Serge und versichert ihm, dass Frankreich verhindern will, dass ich ins Gefängnis komme. Der Ratifizierung des Zusatzabkommens steht er skeptisch gegenüber – alle französischen Vorstöße zu diesem Thema seien bislang von der deutschen Seite zurückgewiesen worden.
Erste Sitzung, 25. Juni 1974. Ich bin nicht allein. Viele meiner Unterstützer sind aus Paris angereist. Richter de Somoskoey hat noch nicht zugesagt, Zeugen der Verteidigung zuzulassen. Er selbst hält es nicht für notwendig. Aber viele Freunde haben mit mir illegale Handlungen begangen, und es liegt auf der Hand, dass ihre Aussagen interessante Einblicke vermitteln würden über die Hintergründe und Lischkas Werdegang. Aber der Richter will dies nicht hören. Er hat einen renommierten Psychiater hinzugezogen, der seine Meinung über mich abgeben soll.
Am Eingang des Gerichts demonstrieren deutscher Frauen, Mitglieder der VVN. Jede trägt ein Plakat, auf dem sie gegen meinen Prozess protestiert und fordert, dass Lischka stattdessen vor Gericht gestellt wird. Der Richter versucht, mich zu provozieren:„ Sie haben Pflichten gegenüber Deutschland und nicht nur gegenüber der Menschheit“. Ich antworte: „Alles, was ich tue, tue ich für Deutschland.“ Das Publikum applaudiert. Es folgt eine Aufzählung der Aktionen. Der Richter liest eine Übersetzung des Kapitels meines Buches vor, in dem der Versuch der Entführung Lischkas beschrieben wird. Der Richter tadelt mich dafür, dass ich den Namen der Straße vergessen habe und sagt: „Das hätte ich nicht vergessen.“ Ich antworte: „Das nächste Mal werde ich sie bitten, meinem Team beizutreten“. De Somoskoey ist sprachlos. Er droht, mich wegen Unverschämtheit ins Gefängnis zu stecken. Marinsky springt wütend auf und sagt: „Sie sagten, Sie würden das Kapitel lesen lassen, hören Sie damit auf, und fahren Sie mit dem Dossier über Lischka fort, das folgt.“ Der Staatsanwalt sieht sich gezwungen, eine Verlesung der Seiten meines Buches über die Karriere von Lischka in der Gestapo zu verlangen, zusammen mit den darin zitierten Dokumenten.
Zweite Sitzung, Donnerstag, 27. Juni. De Somoskoey greift an: „Im Laufe der vorangegangenen Sitzung hat Herr Marinsky zwei Notizen von zwei Personen im Raum erhalten. Wir verstehen, dass Jerusalem sehr an diesem Prozess interessiert ist, aber Herr Marinsky kann bis zum Ende der Sitzung warten, um Anweisungen zu erhalten. Wer sind diese Personen und was war der Inhalt dieser Mitteilungen? Sollte ich sie nicht in das Protokoll aufnehmen?“
Marinsky, sehr höflich: „Ich entschuldige mich für meine Unkenntnis des deutschen Verfahrens; ich hatte bemerkt, dass Notizen zwischen den Richtern ausgetauscht wurden und dachte, dies sei zulässig. Die erste Person war Yehuda Milo, Erster Sekretär der israelischen Botschaft. Ich fragte ihn: „Ist Post für mich da?“, da ich meinen Freunden in Israel die Adresse der Botschaft gegeben habe. Die zweite Person war Alfred Wolman, der Vertreter der Zeitung Yediot Aharonot, den ich fragte: ‚Können Sie mir ein paar Aspirin besorgen?’“ Mit lauter Stimme fuhr er fort: „Aber ich habe meine Erklärungen noch nicht beendet. Sie alle haben Augen, um meine Botschaften zu sehen, aber natürlich hat keiner von Ihnen bemerkt, dass Ihr Schreiber lachte und dem Platzanweiser Notizen schickte, während Sie mit offensichtlicher Langeweile lasen, wie Lischka Juden umbrachte. Das ist eine sehr alte Geschichte, nicht wahr? Wenn das noch einmal passiert, werden meine Mandantin und ich den Saal verlassen müssen. Was die angeblichen Anweisungen aus Jerusalem angeht, so haben Sie offenbar keine Ahnung von der Situation israelischer Anwälte. Ich habe meine Anweisungen vor dreißig Jahren erhalten, als ich erfuhr, dass meine gesamte Familie von den deutschen Nazis in Bialystok umgebracht worden war.“
Der Richter zieht sich kleinlaut zurück. Der Prozess zieht sich hin mit den einundzwanzig Zeugen der Staatsanwaltschaft. Nach den Ursachen des Protests wird nicht gefragt. Dieser Prozess braucht Dynamik. Der Widerstandskämpfer René Clavel vereinbart für den 27. Juni einen Termin mit einem Mitglied des Kabinetts von Giscard d’Estaing. Er teilt dem Minister mit, dass er entschlossen ist, sich mit allen Mitteln im Prozess Gehör zu verschaffen, denn bis jetzt weigert sich der Vorsitzende Richter, Aussagen französischer Zeugen anzuhören. Der Präsident der Republik richtet sich am nächsten Tag auf diplomatischem Wege an den deutschen Außenminister und bringt seine Besorgnis über meinen Prozess zum Ausdruck. Er erinnert auch daran, dass der Bundestag das Zusatzabkommen noch immer nicht ratifiziert hat. Am Samstag, den 29. Juni, ändert de Somoskoey seine Meinung: Das Gericht wird die französischen Zeugen anhören.
Dritte Sitzung, Montag, 1. Juli. Mein treues Team, Jean Pierre-Bloch und René Clavel, sowie Jugendliche der Jüdischen Studentenfront sind anwesend. Lischka ist an der Reihe, auszusagen. Alle meine Freunde haben ihre Medaillen umgehängt, die Verbände haben Fahnenträger geschickt. Ich betrete den Saal zwischen zwei Reihen französischer Fahnen. De Somoskoey protestiert gegen den Brief von Giscard d’Estaing. „Ich kann diesen Brief nicht berücksichtigen. Das ist ein Eingriff in die Unabhängigkeit des Gerichts.“ Er teilt mit, dass der Justizminister auf diese Intervention des Präsidenten der Republik folgendes geantwortet hat: „In Deutschland sind die Richter unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen.“ Am selben Tag erscheint in der israelischen Zeitung Ma‘ariv ein Leitartikel, in dem es heißt: „Diese Intervention war für die öffentliche Moral höchst notwendig, aber sie ist sicherlich ohne Beispiel in der Geschichte der internationalen Beziehungen. Der Schritt von M. Giscard d’Estaing sollte zeigen, mit welcher Ernsthaftigkeit Frankreich die Situation betrachtet. Die Intervention des französischen Staatsoberhauptes hat dem deutschen Gericht, das Beate Klarsfeld vor Gericht stellt, und dem gesamten deutschen Justizapparat unmissverständlich mitgeteilt, dass sie sich vor dem Gericht der Weltöffentlichkeit verantworten müssen.“
Als Lischka in den Zeugenstand gerufen wird, weigern sich die französischen Zeugen, die auf den Bänken im Korridor sitzen, nach dem Vorbild von Julien Aubart, aufzustehen, um dem Gestapo-Chef Platz zu machen. Die Polizei befürchtet, dass die Zeugen Lischka angreifen könnten. Nach einem einstündigen Streit führen die Polizisten Lischka durch einen Seiteneingang in den Gerichtssaal. Es war vereinbart, dass ich ein diskretes Signal gebe, um Unruhe und einen Tumult zu starten, aber erst nachdem Marinsky Lischka verhört hat. Das Verhör beginnt:
MARINSKY: „Haben Sie eine Vorstellung von der Zahl 195590?“
LISCHKA: „Ich weiß nicht, was diese Nummer bedeutet.“
MARINSKY: „Sie erinnern sich doch sicher an Ihre persönliche Nummer in der SS?“
LISCHKA: „Ich erinnere mich überhaupt nicht mehr daran.“
MARINSKY: „Vielleicht erinnern Sie sich an Ihre Parteinummer?“
LISCHKA: „Nein.“
MARINSKY: „Warum wollen Sie nicht über die Jahre von 1936 bis 1945 sprechen? Schämen Sie sich?“
LISCHKA: „Ich weigere mich, diese Frage zu beantworten“, und beruft sich auf sein Recht, die Aussage zu verweigern, die ihn belasten könnte. Der Anwalt, der zeigen wollte, dass Lischka seit Kriegsende ein angesehenes Leben in Deutschland führte, versuchte es mit einem anderen Ansatz:
MARINSKY: „Wie lange leben Sie schon in Köln?“
LISCHKA: „Seit 1950.“
MARINSKY: „Einundzwanzig Jahre in Folge, ist das richtig? Stimmt das?“
LISCHKA: „Ja.“
MARINSKY: „Niemand hat Sie in diesen Jahren angegriffen, bis diese Leute [gemeint sind Beate Klarsfeld und ihre Gruppe] kamen?“
LISCHKA: „Nein.“
MARINSKY: „Keiner hat mit dem Finger auf Sie gezeigt und niemand hat Sie einen Mörder genannt?“
Der Richter protestiert: „Herr Anwalt, Sie wollen damit sagen, dass die Kölner Lischka freiwillig integriert haben. Ich kann eine solche Frage nicht zulassen.“
MARINSKY: „Sie sind es, der das gesagt hat, Euer Ehren.“ Zu Lischka: „Ihre Hände zittern jetzt, vor dreißig Jahren haben sie nicht gezittert.“
Unsere Freunde in den Zuschauerreihen sind aufgestanden und stimmen die Marseillaise an. Es ertönen Rufe wie „Mörder! Nazi!“ Jean-Pierre Bloch, ehemaliges Kabinettsmitglied unter de Gaulle, wird von einem Wachmann an der Kehle gepackt und geschlagen. Polizisten stürmen in den Gerichtssaal. Die Sitzung wird tumultartig aufgelöst. In Frankreich und auch in Deutschland gibt es umfangreiche Pressereaktionen.
Vierte Sitzung, Dienstag, 2. Juli: Lischka schließt seine Aussage ab. Marinsky erinnert sich, wie Lischka reagierte, als wir im Mai 1973 in seinem Büro demonstrierten. „Wie in den guten alten Zeiten, Obersturmbannführer, zeigten Sie sich dort mit einer Pistole und ein Jude stand mit dem Gesicht zur Wand.“
RICHTER: „Ich muss Sie noch einmal darauf hinweisen, dass Sie den Zeugen mit allem Respekt ansprechen müssen, der dem Gericht gebührt. Keine weiteren Fragen dieser Art.“
MARINSKY: „Ja, ich habe das völlig vergessen … Ich muss mich immer wieder daran erinnern, dass die Leute hier nicht gerne an die guten alten Zeiten erinnert werden.“
In einer ruhigeren Atmosphäre werden zwei französische Zeugen, Georges Wellers und Joseph Billig, in den Zeugenstand gerufen. De Somoskoey, der nach der Lektüre der Morgenzeitungen vorsichtiger geworden ist, zeigt sich geduldig. Diese beiden Zeugen sind wichtig. Wellers hat im Laufe von drei Jahren während der deutschen Besatzung gesehen, wie Zehntausende von Juden aus Drancy – dem Vorzimmer des Todes – in die Gaskammern von Auschwitz gebracht wurden. Joseph Billig stellt Lischkas Biographie und seine Karriere in der SS genau dar. Die deutsche Presse berichtet praktisch nichts von diesen wichtigen Aussagen. Müssen wir immer Aufsehen erregen, um das Schweigen zu beenden?
Fünfte Sitzung, Mittwoch, 3. Juli: Der Höhepunkt des Prozesses ist erreicht. Der Richter bezeichnet erneut die Intervention von Giscard d’Estaing als untragbar. Für den deutschen Anwalt, der mich verteidigen soll, ist das Schreiben des Präsidenten der Französischen Republik „eine Drucktaktik, die an die Nazizeit erinnert“. Ich erhebe mich und protestiere: „Herr Jochum ist nicht mein Anwalt, sondern der von Herrn de Somoskoey!“ Ich lobe das Eingreifen von Giscard d’Estaing, das von so vielen Franzosen gewünscht und gebilligt wird.
Der erste Zeuge des Tages ist René Clavel. Mit seinen unangenehmen Wahrheiten irritiert er de Somoskoey so sehr, dass dieser glaubt, Clavel den Nazigruß parodieren zu sehen. Zum Erstaunen aller Anwesenden beschuldigt de Somoskoey Clavel das Gericht zu verhöhnen; er beschließt, keine weiteren französischen Zeugen mehr zuzulassen und erklärt eine Pause. Die anderen Zeugen wollen reingelassen werden; es kommt zu Schubsereien und Drängeleien. Henri Pudeleau wird von einem Wachmann so schwer geschlagen, dass er Rippenbrüche erleidet. Julien Aubart schreit mit einer gequälten Stimme, so dass den Frauen der VVN die Tränen kommen: „Ihr versucht, das zu beenden, was ihr in Auschwitz begonnen habt!“ Pierre-Bloch wird angepöbelt. Diese Vorfälle zeigen große Wirkung. Der FDP-Abgeordnete Ernst Achenbach, der die Ratifizierung des Zusatzvertrags zum Überleitungsabkommen bis jetzt verhindert hat, verliert die Geduld. In einem Radiointerview in Köln fordert er eine Generalamnestie für ehemalige Nazis, aus humanitären und christlichen Gründen: „Als Berichterstatter des Ausschusses im Bundestag werde ich den Ratifizierungsvorschlag sorgfältig prüfen, und das wird dauern, sehr lange dauern.“ Nun richtet sich die öffentliche Aufmerksamkeit auf Achenbach. Von allen Seiten erhalten wir Anfragen zu seinem Dossier.
In der Zwischenzeit trifft sich Serge, der aus Angst vor Verhaftung nicht nach Deutschland einreisen möchte, am Donnerstag, den 4. Juli, mit mir in Lüttich. Wir arbeiten gemeinsam an dem Entwurf meiner Abschlusserklärung.
Sechste Sitzung, Freitag, 5. Juli. De Somoskoey kündigt an, dass heute wegen der Unruhen vom Mittwoch eine geschlossene Sitzung stattfinden wird. Ich erhebe mich und sage: „Euer Ehren, diese Vorfälle sind auf die unmenschliche Art und Weise zurückzuführen, in der Sie diesen Prozess führen; Sie nehmen keinerlei Rücksicht auf die Gefühle der Opfer des Nationalsozialismus.“ Nach diesen Worten versuche ich, den Gerichtssaal zu verlassen. Die Wachleute zwingen mich zu bleiben. De Somoskoey will mir sofort eine Gefängnisstrafe aufbrummen, weil ich das Gericht beleidigt habe. Die Journalisten, die von der Verhandlung ausgeschlossen wurden, sind auf meiner Seite. Sie weigern sich, ihre Nachrichten aus zweiter Hand, durch einige wenige zugelassene Reporter, zu akzeptieren, und reichen eine Beschwerde gegen den Richter ein. Das Gericht leert sich. Der französische Generalkonsul in Bonn darf bleiben, während der israelische Diplomat aufgefordert wird zu gehen. Daraufhin erklärt sich der französische Konsul mit seinem israelischen Kollegen solidarisch und verlässt mit ihm gemeinsam den Gerichtssaal. Staatsanwalt Gehrling beantragt den Urteilsspruch.
Die beantragte Strafe von sechs Monaten soll zur Bewährung ausgesetzt werden. Der Psychiater macht seine Aussage. Zu meiner großen Genugtuung stellt er fest, dass ich völlig normal bin und mich genau aus den von mir genannten Gründen so verhalte, wie ich es tue. Dann hält Marinsky ein lebhaftes Plädoyer in englischer Sprache, dass einige Wochen später von den israelischen Medien veröffentlicht wird. Hier einige Auszüge:
„Herr Vorsitzender, verehrte Richter, in einem weiteren Sinne, in einem kardinalen Sinne, der über jedes juristisch-technische Kriterium hinausgeht: ein Anwalt aus meinem Land hat nicht nur das moralische Recht, sondern die moralische Pflicht, den Fall Beate Klarsfeld zu vertreten. Denn, Herr Vorsitzender, verehrte Richter, für mein Land und sein Volk sind die hunderttausend Männer, Frauen und Kinder, die SS-Obersturmbannführer Lischka in den Tod schickte, weit mehr als gesichtslose Zahlen. Sie sind unsere Brüder und Schwestern, unsere Mütter und Väter. Sie sind eine lebendige Erinnerung. Eine Erinnerung, die uns dazu zwingt, uns zur Verteidigung dieser Frau zu versammeln, die ihre Freiheit und ihr Wohlergehen geopfert hat, um die noch immer auf freiem Fuß befindlichen Massenmörder zu entlarven und zu fordern, dass sie vor Gericht gestellt werden. Ich bete und plädiere nicht nur für Israel oder Frankreich, nicht nur für Beate Klarsfeld, sondern auch in der Hoffnung, dass ein neues Deutschland dieses Plädoyer für Gerechtigkeit erhören wird.“
Ich bin als letzte an der Reihe und sage folgendes: „Wenn Sie diesen Prozess auf die Taten des zivilen Ungehorsams beschränken, die ich begangen habe, ohne auf das schwerwiegende Problem einzugehen, was diese Taten ausgelöst hat, werden Sie mich sicherlich für schuldig befinden und mich mit oder ohne Bewährungsstrafe verurteilen. Aber Sie werden nicht Ihrer Pflicht nachkommen. Sie haben die Möglichkeit, dem Bundestag zu zeigen, dass es seine Pflicht ist, das Zusatzabkommen zu ratifizieren und so den Sinn für Gerechtigkeit in diesem Land zu stärken.
Für meine Freunde und mich war es nicht leicht, Gesetze zu brechen, um Gerechtigkeit zu erlangen. Auch für Sie wäre es nicht leicht, mich freizusprechen, da Sie wissen, dass ich eine illegale Tat begangen habe. Aber wenn Sie es tun, werden Sie etwas Wertvolles in die deutsche Justiz einbringen – und zwar, indem Sie sich nicht an den Buchstaben des Gesetzes halten, wie es so viele andere deutsche Richter vor Ihnen leider getan haben. Was ich von Ihnen verlange, ist eine mutige Entscheidung.
Was mich betrifft, so habe ich lange im Namen der Männer und Frauen gekämpft, die der Folter, dem Fallbeil oder den Erschießungskommandos ausgesetzt waren. Sie können sich sicher sein, dass ich Ihr Urteil nicht fürchte. Nein, es ist nicht Angst, die mich in diesem Moment bewegt, sondern Hoffnung – weniger für mich selbst als für Sie und die BRD. Ich habe die Hoffnung, dass Sie mich freisprechen werden. Wenn Sie das tun, tragen sie dazu bei, dass das deutsch-französische Zusatzabkommen endlich unterzeichnet wird und verschaffen der deutschen Justiz den Respekt, den sie sicherlich dringend braucht.“
Das Urteil soll am Dienstag, den 9. Juli, verkündet werden. In der Zwischenzeit geben weitere Ereignisse unserer Sache Auftrieb. Am 7. Juli billigt die Knesset in einer Sondersitzung einstimmig einen Protest gegen meinen Prozess. Das Kölner Gericht wird verantwortlich erklärt für gewaltsame Maßnahmen gegen ehemalige Deportierte. Alle in der Knesset vertretenen Parteien haben eng zusammen gearbeitet. Ygal Allon, der Außenminister Haika Grossman, Meir Palik (Moked) und Ehud Olmerd (Freies Zentrum) hielten jeweils eine Rede.

Montag, 8. Juli. In Bonn findet ein Gipfeltreffen statt zwischen dem neu gewählten Bundeskanzler Helmut Schmidt und Giscard d’Estaing. Am Abend verkündet Schmidt zum Erstaunen der Deutschen: „Ich habe mit dem Präsidenten der Französischen Republik beschlossen, dass das Zusatzabkommen noch vor Ende des Jahres ratifiziert wird.“ Das Gipfeltreffen sollte sich mit der Wirtschaft befassen, aber es wurde mit den politisch-justiziellen Fragen rund um das Abkommen eröffnet.
Die französische Presse berichtet auf den Titelseiten über den Prozess gegen mich. In einem Artikel von Maurice Delarue, dem Leiter des diplomatischen Dienstes von Le Monde, wird großer Druck auf Bonn ausgeübt. „Die Europäische Union ist nicht nur eine Union des Handels, der Fabriken, des Getreides und der Währung. Sie ist auch eine Union der Menschen. Nicht mit dem Deutschland von Lischka und den Richtern von Köln wollen die Franzosen die Europäische Union gestalten, sondern mit dem Deutschland von Willy Brandt und Beate Klarsfeld.“
Montag, 9. Juli. Wir sind mit einem von der LICA gecharterten Bus nach Bonn gefahren Am Morgen legen wir Blumen am Denkmal für deutsche Antifaschisten nieder und lesen eine Passage aus der Rede von Thomas Mann „An die Deutschen“, die er im Exil in den USA gehalten hat. Dann legen wir Blumen nieder am ehemaligen Gestapo-Gefängnis in Köln, wo Zwangsarbeiter und Mitglieder der französischen Résistance hingerichtet worden sind. M. Katzman, Kantor der Synagoge in der Rue Copernic in Paris, liest den letzten und großartigen Brief von Abbé Deroy, der hier 1943 guillotiniert wurde.
Um 14 Uhr sind wir dann im Gerichtsaal, wo heute das Urteil verkündet wird. Zum Erstaunen fast aller, aber nicht zu meinem, da ich mit de Somoskoey’s Wut gerechnet hatte, lautet das Urteil auf zwei Monate Gefängnis ohne Verpflichtung, die bereits verstrichene Zeit in Präventivgefängnis zu verbüßen (37 Tage – 16 Tage im Jahr 1971 und 21 Tage im Jahr 1974) und ohne Verpflichtung, die verbleibende Zeit (23 Tage) sofort zu verbüßen. Meine Anwälte werden meinen Fall dem Bundesgerichtshof in Karlsruhe zur Revision vorlegen.
Im Gerichtssaal sitzen Reporter*innen aus der ganzen Welt sowie die ehemaligen WiderstandskämpferInnen und Deportierten aus Frankreich. Sie beginnen die Marseillaise zu singen. Protest und Empörung sind groß.
Mittwoch, 10. Juli, Paris. Bei einer großen Demonstration vor der deutschen Botschaft in Paris bin ich von einer begeisterten Menge umgeben. Tausende von Menschen fordern die Ratifizierung des Zusatzabkommens und erklären ihre Unterstützung für mich. Unsere Wohnung wird von der französischen und ausländischen Presse belagert. Ich kann nicht aufhören, Fragen zu beantworten und aufzuklären. Achenbach scheint nun zum Sündenbock für das schlechte Gewissen der Deutschen herhalten zu müssen. Tatsächlich wird in politischen Kreisen sofort erkannt, dass das Urteil gegen mich eine Katastrophe für die Bundesregierung ist, die gerade ihr fünfundzwanzigjähriges Bestehen feiert. Die Jungdemokraten der Liberalen Partei Achenbachs (FDP) kommen zu uns nach Paris und nehmen zweitausend Fotokopien von Dokumenten aus unseren Akten mit zurück. Sie halten eine Pressekonferenz in Bonn ab und fordern Achenbach auf, als Berichterstatter des Bundestagsausschusses zurückzutreten. Am 22. Juli ist es dann soweit. Achenbach tritt zurück. Die Ratifizierung des Zusatzabkommens zum Überleitungsvertrag wird genehmigt.
Zu diesem Zeitpunkt bin ich bereits mit Serge, Arno, Lida und Petia in Israel. Wir werden in Jerusalem geehrt. In Deutschland ändert sich nun die öffentliche Meinung – mit Ausnahme der extremen Rechten – zu meinen Gunsten. Ein liberaler Abgeordneter schlägt mich für den Theodor-Heuss-Preis vor, „weil ich das deutsche Gewissen geweckt habe“. Auch von der „Christlich-Politischen“ Bewegung werde ich für das Bundesverdienstkreuz vorgeschlagen. Vielleicht bin ich eines Tages ein Prophet in meinem eigenen Land.