Der Lischka Prozess
Serge Klarsfeld hat nie viel über sich selbst gesprochen. Man kennt ihn als Jurist, Historiker, „Nazi-Jäger“ und Ehemann von Beate Klarsfeld. Auskunft über sein Leben und die Motive für sein Engagement hat er zum ersten Mal gegenüber seinem Freund und Mitstreiter Claude Bochurberg gegeben. Die Gespräche sind in einer zehn Kapitel und 322 Seiten umfassenden Edition 1997 unter dem Titel „Entretiens avec Serge Klarsfeld“ erschienen (Redigierte Fassung, Anne Klein, Serge Klarsfeld – Porträt und Zitate, In: Anne Klein (Hrsg.), Der Lischka-Prozess. Eine jüdisch-französisch-deutsche Erinnerungsgeschichte, Berlin: Metropol 2013, S. 141-150).
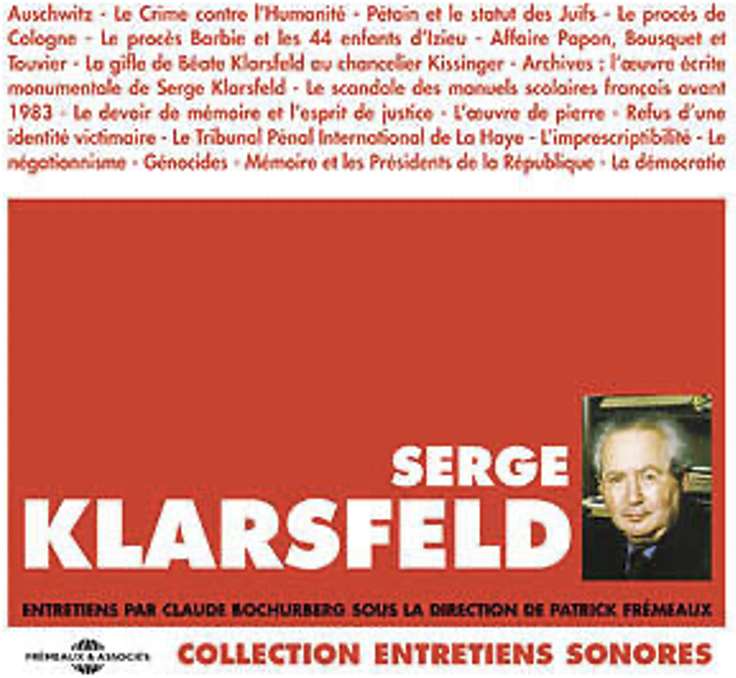
Wie Claude Bochurberg in seinem Vorwort erklärt, war Anlass für die Gespräche mit Serge Klarsfeld, dass Präsident Jacques Chirac während der Gedenkfeiern zur Erinnerung an die Opfer des Rafle du Vélodrome d’Hiver2 am 16. Juli 1995 die französische Verantwortung für die Deportation der Juden anerkannt hatte. Dieser späte „victoire démocratique“ (demokratischer Sieg) zeigte, dass nun historische Verantwortung für die Kollaboration mit dem Nazi-Regime auf der Tagesordnung stand und dies bis in die höchsten Instanzen des französischen Staates. Nach 30 Jahren Streit um die Strafverfolgung von NS-Tätern hatten Serge und Beate Klarsfeld, umgeben von einem kleinen Netzwerk von Aktivistinnen und Aktivisten, den „combat opiniâtre“ (Meinungsstreit) gewonnen. Damit fand auch das Lebenswerk Serge Klarsfelds Anerkennung: Er hatte nicht nur zusammen mit Beate Klarsfeld seit den 1960er Jahren gegen die Straflosigkeit der NS-Verantwortlichen gekämpft und dafür gesorgt, dass viele von ihnen vor deutsche und später auch vor französische Gerichte gestellt wurden, sondern er hat auch umfangreiche schriftliche Beweise für deren Beihilfe bei den NS-Verbrechen zusammengetragen. Mit der Veröffentlichung der von Kurt Lischka und Herbert Hagen handschriftlich unterzeichneten Deportationsbeschlüsse in den 1970er Jahren wurde ein bislang unbekanntes historisches Wissen über die NS-Verbrechen in Frankreich und die französische Kollaboration der Öffentlichkeit in beiden Ländern zugänglich gemacht. Weiterhin hatte Serge Klarsfeld damit begonnen, die Biografien der aus Frankreich deportierten Kinder zu rekonstruieren. Er hatte in Archiven recherchiert, Kontakte zu überlebenden Angehörigen aufgenommen und für jedes jüdische Kind Dokumente und auch Fotos zusammengetragen. Das „Mémorial des enfants juifs déportés“ ist ein Meisterwerk dokumentarischer Geschichtsforschung.

Serge Klarsfelds Eltern kamen beide aus großbürgerlich-jüdischen Familien. Seine Mutter Raissa wurde 1904 in Cahul, einer Stadt in Bessarabien, geboren. Bessarabien, das weitestgehend dem heutigen Moldawien entspricht, hatte bis 1918 zu Russland gehört, wurde dann rumänisch und gehörte seit 1944 zur Sowjetunion. Die Familie war prozaristisch eingestellt und im Getreidehandel sowie in der Pharmazie tätig. 1920 ging Raissa mit ihrer Schwester Lida zum Studium nach Paris. Serge beschreibt sie als eine religiöse Frau, die fünf Sprachen beherrschte: Russisch, Deutsch, Jiddisch, Französisch und Rumänisch. Serge Klarsfelds Vater Arno wurde in der internationalen Hafenstadt Braila, ebenfalls in Bessarabien, geboren. Er sprach acht Sprachen und war als Anwalt tätig.
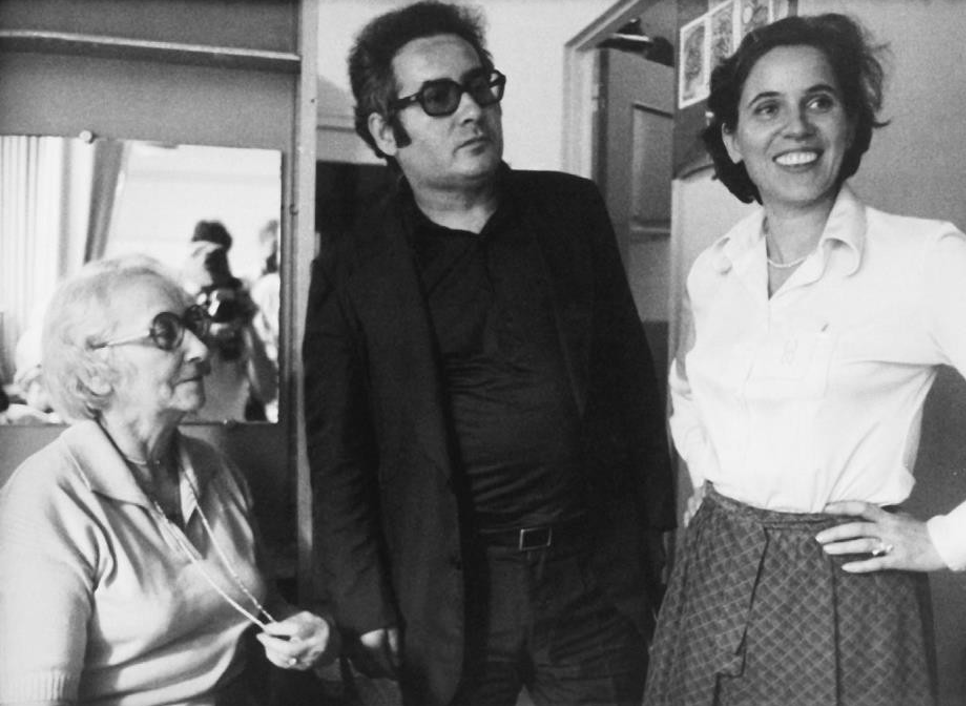
Die Eltern von Serge Klarsfeld lernten sich in Paris kennen und heirateten im dortigen 5. Arrondissement. Es war keine religiöse Hochzeit, wie Serge Klarsfeld erzählt: „Mein Vater hat seine Bar Mitzwa nicht gemacht. Ich auch nicht. Aber ich wurde beschnitten. Das strikte Minimum […].“
Serge wurde am 17. September 1935 in Bukarest geboren, aber hauptsächlich lebte die Familiein Paris. Als die Deutschen 1940 Frankreich überfielen, kämpfte sein Vater auf französischer Seite; er wurde von den Deutschen gefangen genommen und am 6. Juni 1940 wieder freigelassen. Die Mutter hatte währenddessen die Kinder in einem Heim der Œuvre de Secours aux Enfants (OSE) im Department Creuse untergebracht. Im Oktober 1940 zog die Familie nach Nizza, weil man in der italienischen Zone vor antijüdischen Maßnahmen geschützt war. Der Vater schrieb einen Brief an den Präsidenten des französischen Kollaborationsregimes in Vichy, Maréchal Pétain, dass er eine Erwerbstätigkeit suche, um seine Familie ernähren zu können. Daraufhin erhielt er das Angebot, im Casino in Monte Carlo zu arbeiten. Diese Tätigkeit sicherte nicht nur den Lebensunterhalt der Familie, sondern ermöglichte dem Vater längerfristig entsprechende Kontakte, um die Résistance unterstützen zu können.
Ab Januar 1943 lebte die Familie auf einem Bauernhof in Montmaur in Südostfrankreich in der Nähe von Gap. Hier wurden im Auftrag des patriotisch orientierten Netzwerks La Chaîne, dem entfernt auch François Mitterrand angehörte, falsche Papiere für die Résistance hergestellt. Die Mutter war derweil wieder mit den Kindern nach Nizza gegangen. Der Präfekt des Departments Bouches-du-Rhône hatte die Liste der registrierten Juden vernichten und gefälschte Papiere für sie ausstellen lassen. Am 8. September 1943, kurz nach dem Attentat auf Mussolini, fielen jedoch die Deutschen in der Stadt ein. Das Kommando von Alois Brunner organisierte brutale Razzien, die sich insbesondere durch ihre durchdacht aggressiven Methoden auszeichneten.6 Unterstützt wurden die Deutschen von den rechtsextremen Gruppen um Jacques Doriot und der Miliz von Joseph Darnand. Sie sperrten Straßen zu beiden Seiten ab und kontrollierten systematisch die Passanten. Die Männer wurden unter Brücken geführt und dort untersucht, ob sie beschnitten waren. Nachts wurden die kleinen Gänge zwischen den Häusern durchleuchtet. Die Deutschen drangen in die Wohnungen ein, rissen die Anwohner aus dem Schlaf, kontrollierten alle und nahmen vor allem die Männer mit. Innerhalb von drei Monaten gab es 2.000 Festnahmen.7
Die Familie Klarsfeld hatte einen Verschlag gebaut – eine Art doppelte Zimmerwand aus Holz – der von einer Leine, auf der Wäsche zum Trocknen hing, verdeckt wurde. Am 30. September gegen Mitternacht fielen grelle Lichter von Scheinwerfern in die Wohnung. Alle waren schlagartig hellwach. Die Kinder mussten sich im Verschlag verstecken. Von überall hörte man Schreie. Arno Klarsfeld hatte sich bereit erklärt, mit den Deutschen zu gehen, um die Familie vor allzu heftigen Gewaltausbrüchen zu schützen. Er wurde mit den anderen gefangen genommenen Juden im Hotel Excelsior in Nizza festgehalten und später von dort nach Drancy gebracht, dem Zwischenlager in der Nähe von Paris auf dem Weg nach Auschwitz und Sobibór. Nun war klar, dass die Familie Klarsfeld Nizza verlassen musste. Aber es sollte noch drei Monate dauern, bis ein anderer sicherer Ort gefunden war.
Der Sohn des Rabbiners Poliakov kam in die Stadt und sagte, man könne nach Puy-en-Velay gehen. Dort sei keine Gestapo, und der diensthabende deutsche Kommandant interessiere sich nicht für Juden. Die Mutter und die Kinder ließen sich daraufhin in dem kleinen Nachbarort Saint-Julien-Chateuil nieder. Inmitten der katholischen Bevölkerung lebte die Familie in Ruhe. Sie waren als Ausländer registriert, also als Rumänen, aber nicht als Juden.8 Als mit dem Anliegen an die Familie herangetreten wurde, sie sollten zum Katholizismus konvertieren, verwies die Mutter darauf, dass der Vater darüber entscheiden würde, wenn er aus der Kriegsgefangenschaft zurückgekehrt sei. Damit war das Thema vertagt. Ende September 1944 ging die Mutter mit den Kindern in das inzwischen befreite Paris. Es dauerte ein Jahr lang, bis per Gerichtsprozess entschieden wurde, dass die Familie ihre Wohnung, die in der Zwischenzeit beschlagnahmt worden war, zurückerhielt. Die Mutter arbeitete als medizinische Helferin bei der OSE und kümmerte sich um die Shoah-Überlebenden, die aus den Lagern zurückkehrten. Einige von ihnen hatten Arno Klarsfeld in dem Lager Fürstengrube in Schlesien gesehen, wo er inden Kohleminen gearbeitet hatte und später auch in Auschwitz-Birkenau. Dorthin war er deportiert worden, nachdem er sich gegen einen Kapo zur Wehr gesetzt hatte. Im August 1944 wurde er in der Gaskammer ermordet.9 Serge Klarsfeld beschreibt ein Gefühl der Einsamkeit, wenn er sich daran erinnert, wie er als kleiner Junge ab Ende 1945 mit nur einigen wenigen anderen Schülerinnen und Schülern die jüdische Schule Maimonides in Paris besuchte. Für ihn war es eine „communaute de destin“, eine Schicksalsgemeinschaft. Es gab keine Verwandten in Frankreich, aber wohl Freunde.
Die Mutter ging bald nach Kriegsende mit Serge und seiner Schwester nach Bukarest, wo im Vergleich zu Paris kein Versorgungsmangel herrschte; dies änderte sich allerdings wenigspäter, als die Kommunisten das Land abriegelten. Die Familie ging erneut zurück nach Paris. Seit 1953 intensivierten sich Serge Klarsfelds Beziehungen zu Israel. Er hielt sich längere Zeit in einem Kibbuz auf. 1965 besuchte er zum ersten Mal Auschwitz, was für seine politische Bewusstseinsbildung außerordentlich prägend war.10 1967 nahm er für Israel am sogenannten Sechstagekrieg teil.
Serge Klarsfeld absolvierte verschiedene Studiengänge, unter anderem studierte er Geschichte an der Sorbonne und schloss 1960 das Studium der Politikwissenschaft am Institut d’études politiques de Paris (IEP) mit einem Diplom ab. Ab 1970 studierte Klarsfeld Rechtswissenschaft und wurde Rechtsanwalt in Paris. Er arbeitete für den Rundfunk ORTF und für die Getreidehandelsfirm Continental Grain“. Engagiert kämpfte er für die Aufklärung der NS-Verbrechen in Frankreich und Deutschland. In zahlreichen Gerichtsprozessen trat er als Anwalt der Shoah-Überlebenden auf.

Besonders aufmerksam beobachtete Serge Klarsfeld zusammen mit andere jüdischen Aktivist*innen aus Frankreich neonazistische Aktivitäten. Er organisierte Protestdemonstrationen und sprengte völlig furchtlos große Versammlungen mit neuen und alten Nazis wie beispielsweise am 5. Dezember 1976. Im Bürgerbräukeller, dem berühmten Wirtshaus in München, in dem Hitler 1923 geputscht hatte, fand eine Versammlung der neonazistischen DVU statt.
Zusammen mit seinem Mitstreiter Alain Birn besucht Serge Klarsfeld diese Veranstaltung. Als er das Rednerpult betrat, um sich an das Publikum zu wenden, brach ein Tumult aus. Serge wurde geschlagen und mit Gewalt aus dem Saal gedrängt.
Als Historiker hat sich Serge Klarsfeld um die wissenschaftliche Dokumentation der Shoah in Frankreich verdient gemacht. In unermesslicher Kleinarbeit rekonstruierte er die Biografien und Fotos der 11.000 aus Frankreich deportierten und in Auschwitz ermordeten Kinder.12 Er baute Kontakt zu Shoah-Überlebenden und deren Angehörigen in aller Welt auf. Dies half ihm, die gewaltsame Trennung von seinem Vater, dessen Ermordung und das eigene Überleben zu verarbeiten.

Am 1. November 1960 lernten sich Serge und Beate auf einer Universitätsfeier kennen. Esbegann eine große, bis heute andauernde Liebe zwischen einer Deutschen und einem deutsch-jüdisch- rumänischen Franzosen. Das Leben als Paar und mit den Kindern war und ist für Serge Klarsfeld ein großes Glück und, wie er sagt, in der ungewöhnlichen jüdisch–nichtjüdischen Konstellation ein leibhaftiges „Dementi dessen, was passiert war“.13
Das Paar
Ich habe immer geträumt, sogar bevor ich Beate kannte, eine Frau zu haben, mit der ich alles teilen und große Abenteuer würde erleben können. Ich habe das erhalten. Tatsächlich habe ich keine persönlichen Ambitionen; ich hatte nie spezifische Ziele, außer glücklich zu sein […].15
Leben
Alles spielt sich in kurzen Zeiträumen ab. Daher muss man das Leben ein wenig wie etwas Absolutes leben und sich nicht zu viele Fragen stellen über eine mögliche Zukunft […]. Man muss sich die eigenen Wertvorstellungen klarmachen und diese Werte absolut leben […].Intensiv leben, ohne den Blick zu verlieren, wer man ist. Viele Dinge sind schwarz, viele Dinge sind fröhlich […]. Intensiv leben, ohne aus den Augen zu verlieren, wer man ist. Leben, ohne etwas zu bereuen von dem, was man tut, ohne die ethischen Grenzen zu verletzen.16
Überleben
Ich spreche nicht von den Albträumen. Aber die haben mich begleitet. Das ist der Referenzpunkt meines Lebens. Jedes Mal, wenn ich in einer schwierigen, gefährlichenSituation bin, erinnere ich mich an jenen Moment. Zwischen dem Leben und dem Tod war nur ein Übergang von einigen Zentimetern. Wenn die Gestapobeamten die Wandverkleidung berührt hätten, hätten sie gemerkt, dass sie aus Holz war und nicht aus Stein. Und ich hätte in Auschwitz geendet. In einer gewissen Art und Weise bin ich in diesem Moment gestorben, und gleichzeitig bin ich ein Überleben- der: In jenem Moment bin ich ein Überlebendergeworden.17
Authentizität
Wie die meisten Kinder, die überlebt haben, habe auch ich gesehen, wie meine Elternverschwunden sind. Das ist ein derartiger Schock, dass ich immer wieder träume, dass mein Vater zurückkehrt. Ich freue mich in meinen Träumen, obwohl ich weiß, dass es unmöglich ist. Aber das Gefühl, ihn zurückkehren zu sehen, ist ein authentisches Gefühl, das sich durch die Zeit nicht ändert. Es bedarf nur einer Kleinigkeit, damit ich wieder wie als Kind fühle. Es ist wahr, ich habe lange auf meinen Vater gewartet, es gelang mir nicht zuzugeben, dass er möglicherweise tot sein könnte.18
Widerstand I
In einem Universum, in dem inhumane Regeln herrschen, behält man, wenn man Widerstand leistet, seine Würde, aber man verliert ziemlich sicher das Leben. Man muss sich entscheiden.19
Widerstand II
Wir haben verstanden, dass es mutiger und eindeutiger Gesten bedurfte. Gesten sind essentiellmutig, wenn man das Gesetz anerkennt und sich gleichzeitig verpflichtet fühlt, das Gesetz zu brechen, um Gerechtigkeit zu erlangen. Man übernimmt damit viel Verantwortung, aber man weiß um die Wirksamkeit. Wenn die Aktion auf einer authentischen Legitimität beruht, verstehen das die Menschen gut. Das ist natürlich nicht immer der Fall.20
Militanz
Von Beginn an hätten wir die Möglichkeit gehabt zu einer dramatischen Lösung: einen derKriminellen zu töten. Das wäre nicht schwierig gewesen […]. Das wäre tatsächlich eineLösung gewesen, aber eine Lösung der Verzweiflung, die keinen positiven Effekt gehabt hätte. Daher haben wir einen anderen Weg gewählt, der darin bestand zu versuchen, die wichtigsten dieser Verbrecher von ihren eigenen Kindern verurteilen zu lassen. Das war in unserem Verständnis die wirkliche Strafe […]. Wir hatten also die Wahl, blutige Attentate zu begehen oder uns in Opfer zu verwandeln, wann immer es nötig erschien, um unsere Ideen und unseren Wunsch nach Gerechtigkeit nach vorne zu bringen. Unsere Strategie bestand darin, mit Takt zu handeln und in eine bestimmte Form der Illegalität abzutauchen, um uns im Gefängnis wieder zu finden, einen Skandal zu erzeugen und diesen anschließend zu nutzenmit dem Ziel, die deutsche Gesellschaft zu beugen.21
Glück
Um sich ganz und gar dem hinzugeben, was man tut, speziell in dem Kampf, den wir aufgenommen hatten, brauchte man eine gute Dosis Optimismus. Nur die Leute, die das Glück empfinden können, agieren, indem sie Berge bewegen.22
Status der Opfer
Die Aktionen des Widerstands sind besser angesehen. Die Deportation der Widerstandskämpfer hat mehr Anlass zu Berichten gegeben als die Deportation der Juden. […] es handelte sich um zwei verschiedene Deportationen. Die Widerstandskämpferbezahlten in gewisser Weise den Preis für ihr Engagement. Die Juden hatten nichts vorzuweisen, außer geboren zu sein. Am Ende des Weges der Widerstandskämpfer gab es keine Selektionen, keine Gaskammern [….]. Ein anderer grundlegender Unterschied war: Die Widerstandskämpfer wurden nicht mit ihren Familien deportiert, während meist alle Mitglieder einer jüdischen Familie deportiert wurden.23
Söhne und Töchter der Deportierten
Wir repräsentieren wirklich eine aktive und wirksame Kraft, das haben wir bewiesen, nicht nur gegenüber uns selbst, sondern gegenüber der Welt. In Köln, nach mehreren Jahren am Ende eines Dramas der eisernen Faust, haben wir die deutsche Gesellschaft in die Pflicht genommen, zur Überraschung aller Beobachter, und sie mit hartnäckigem Druck gezwungen, die bislang unbestraften Verantwortlichen für die Deportation unserer Eltern anzuklagen und zu verurteilen.24
Juden
Die Juden sind gleichzeitig Träger einer Idee der Demokratie, der Moral und auch derFreiheit. Die jüdische Tradition ist offen für die Debatte, die Kritik und selbst- verständlich für den Geist der Gerechtigkeit. Aus all diesen Gründen kündigen die Juden und ihre Moral dieDemokratie an, und sie können sich nur in diesem Sinn entwickeln. Angesichts des Regimesvon Hitler konnte diese Art des Seins nur eine Provokation bedeuten.25
Kölner Prozess
Einige Tage vor dem Urteilsspruch haben wir eine große Demonstration organisiert – es war der Jahrestag der Machtübernahme Hitlers –, bei der nahezu 1500 Juden in einem Schweigemarsch durch die Straßen Kölns zogen, zum großen Erstaunen der Deutschen.26
Kinder
Die einzigen Kinder, die aus Frankreich deportiert worden sind, waren die jüdischen Kinder. [Wenn man darauf hinweist,] verteidigt man kein Privileg, sondern fordert nur den simplen Respekt vor der Wahrheit.27
Justiz
Ich habe die juristischen Verfahren gewählt als pädagogisches Mittel, um die öffentliche Meinung zu informieren. […] die Erinnerung appellierte an das Gewissen eines jeden, um alles so transparent wie möglich zu machen.28
Zivilisation und Barbarei
Dieser Massenmord, organisiert von einem der zivilisiertesten Länder in Europa, ist Grund genug, für lange Zeit die Befragung des Gewissens zu veranlassen.29
Anmerkungen
von Beate und Serge Klarsfeld und der FFDJF
Auswahlbibliografie
Serge und Beate Klarsfeld‚
Als Verleger: Georges Wellers, La Solution finale et la mythomanie néo-nazie. L’Existence des chambres à gaz et le Nombre des victimes de la Solution finale, New York 1979.
Als Herausgeber: Le Mémorial de la déportation des Juifs de France, Paris 1994. The Children of Izieu. A Human Tragedy, New York 1984 (Deutsche Ausgabe: Die Kinder von Izieu. Eine jüdische Tragödie, Berlin 1991.
Beate Klarsfeld
Die Geschichte des PG 26 33 930 Kiesinger, Darmstadt 1969.
‚Mit Joseph Billig, Kiesinger oder der subtile Faschismus, Berlin 1969. Wherever They May Be!, New York 1975.
Noch 312 Nazis entführen. Ex-Obersturmbannführer sollte der erste sein, in: Konkret, 8. 4. 1971.
Politik und Protest, Die Überlebenden und ihre Kinder, in: Anne Klein/Jürgen Wilhelm (Hrsg.), NS-Unrecht vorKölner Gerichten nach 1945, Köln 2003.
Serge Klarsfeld
Die Endlösung der Judenfrage. Deutsche Dokumente 1941–1944, Paris 1977 (La Solution finale de la question juive, Joseph Billig, 1977).
Le Mémorial de la déportation des Juifs de France. Listes alphabétiques par convois des Juifs déportés de France, Paris 1978.
Als Herausgeber: The Holocaust and the Neo-Nazi Mythomania, New York 1978.
Le Livre des otages. La politique des otages menée par les autorités allemanded’occupation en France de 1941 à 1943, Paris 1979.
L’Album d’Auschwitz. Lili Jacob’s album, Paris 1980.
Mit Maxime Steinberg (Hrsg.), Die Endlösung der Judenfrage in Belgien. Doku- mente, New York 1980.‘
Mit André Kaspi und Georges Wellers, La France et la Question juive. 1940– 1944, Paris 1981.
Mit Maxime Steinberg, Le Mémorial de la deportation des Juifs de Belgique, Brüssel 1982.‘
Le Procés de Cologne, Paris 1982.
Memorial to the Jews. Deported from France 1942–1944. Documentation of the deportation of the victims of the Final solution in France, New York 1983.
Vichy-Auschwitz, le role de Vichy dans la Solution finale de la question juive en France. 1942, Bd. 1, Paris 1983.
Vichy-Auschwitz, le role de Vichy dans la Solution finale de la question juive en France. 1943–1944, Bd. 2, Paris 1985.
Documents Concerning the Destruction of the Jews of Grodno. 1941–1944, 6 Bde., hrsg. von der Beate Klarsfeld Foundation, New York 1987.
Vichy-Auschwitz. Die Zusammenarbeit der deutschen und französischen Behörden bei der „Endlösung der Judenfrage“ in Frankreich, aus dem Französischen übersetzt von Ahlrich Meyer, Nördlingen 1989.
La Rafle de la rue Sainte-Catherine à Lyon, Paris 1987.
Les Transferts de Juifs de la region préfectorale de Bordeaux vers Drancy, Paris 1987.
Mit Georges Wellers und FFDJF, Mémoire du genocide. Un recueil des cent meilleurs articles du Monde juif sur la Shoah, Paris 1987.Als Herausgeber: Les Lettres de Louise Jacobson, 1er Septembre 1942–13 Février 1943, Paris 1989.
Mit David Olère, 1902–1985. Un peintre au Sonderkommando à Auschwitz.
L’œil du témoin. Katalog, New York 1989.
Le Statut des Juifs de Vichy. 3. octobre 1940 et 2. juin 1941. Documentation, Paris 1990.
Serge Klarsfeld, 1941. Les Juifs en France. Préludes à la Solution finale, Paris 1991.
Mit Raymond-Raoul Lambert, Les transferts de juifs de la région de Marseille vers les camps de Drancy ou deCompiègne. En vue de leur déportation. 11 août 1942–24 juillet 1944, Paris 1992.
Les Transferts de Juifs de la région préfectorale de Nice vers Drancy, Paris 1993. Les Transferts de Juifs de la région préfectorale de Montpellier vers Drancy, Paris1993.
Le calendrier de la persécution des juifs en France. 1940–1944, Paris 1993. Le mémorial des enfants juifs déportés de France, Paris 1994. French Children of the Holocaust. A Memorial, New York 1996.
Georgy, un des 44 enfanfts de la Maison d’Izieu, Paris1997
La spoliation dans les camps de province, Paris 2000.
Le calendrier de la persécution des Juifs de France. 1940–1944, Paris 2001.
Von der F. F. D. J. F. und der Beate Klarsfeld Foundation herausgegeben
Joseph Billig/Georges Wellers, The Holocaust and the neo nazi Mythomania, New York 1978.
Paul Tager/Isaac Schneersohn/Raymond Sarraute, Les Juifs sous l’Occupation, recueil des textes anti-juifsofficiels francais et allemands. 1940–1944, Paris 1982.
Max Wolfshaut Dinkes, Échec et mat. Récit d’un survivant de Pchemychl en Galicie/Max Wolfshaut-Dinkes; préf. de Me S. Klarsfeld, Paris 1983.
Jean Claude Pressac, The Struthof Album. Study of the gassing at Natzweiler- Struthof of 86 Jews whose bodies were to constitute a collection of skeletons. A photographic document, New York 1985.
Jean-Claude Pressac, Auschwitz. Technique and Operation of the Gas Chambers, New York 1989.
Jean-Claude Pressac, Truth Prevails, New York 1990.
Noël Calef, Drancy 1941. Camp de représailles. Drancy la faim, hrsg. von Serge Klarsfeld, Paris 1991.
Gilles Cohen, Les Matricules tatoués des camps d’Auschwitz-Birkenau, Paris 1991.
Isaac Schoenberg, Lettres à Chana, Camp de Pithiviers, mai 1941–juin 1942, hrsg. und kommentiert vonSerge Klarsfeld, Orléans 1995.
Denis Torel und Fernand Detaille, Monaco sous les barbelés, Paris 1997.